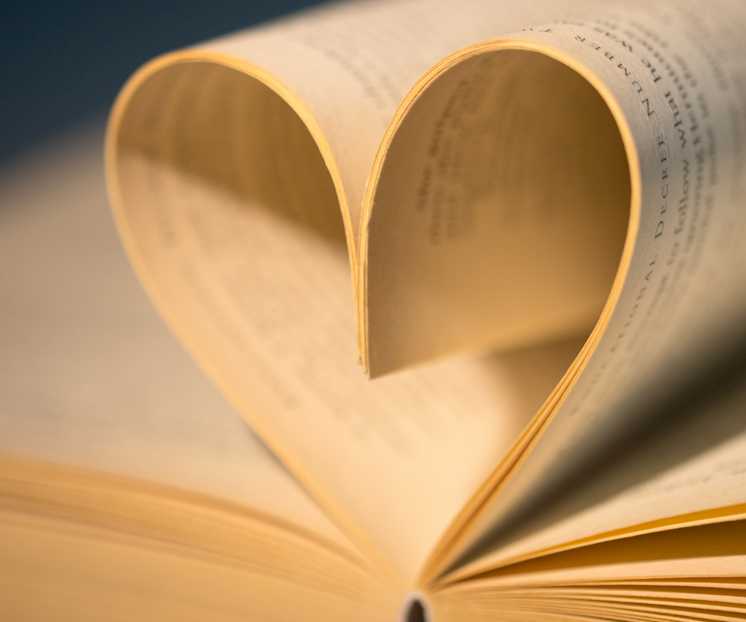Was ist Pränataldiagnostik?
Wird unser Kind gesund zur Welt kommen? Ein Frage, die sich viele Paare stellen. Mit der Pränataldiagnostik, die zusätzlich zu der regulären Schwangerenvorsorge angeboten wird, sucht man gezielt nach Störungen in der Entwicklung des Kindes. Wir stellen die wichtigsten Untersuchungen vor und was es zu beachten gilt.
Zur Pränataldiagnostik gehören spezielle Untersuchungen, die über die regulären, im Mutterpass und in den Mutterschafts-Richtlinien vorgesehenen Vorsorgeuntersuchungen hinausgehen.
Mit ihnen wird gezielt nach Hinweisen auf mögliche Chromosomenabweichungen, erblich bedingte Krankheiten und Fehlbildungen beim ungeborenen Kind gesucht. Viele Paare erhoffen sich mit diesen Untersuchungen die Beruhigung, dass alles mit dem Kind »in Ordnung« ist.
Vorab sollte man allerdings bedenken:
- Fast alle Kinder werden gesund geboren.
- Die Ergebnisse sind oft nicht eindeutig und erfordern weitere Untersuchungen.
- Viele Störungen und Behinderungen sind zwar durch diese Untersuchungen erkennbar, aber während der Schwangerschaft nicht behandelbar.
- Die Untersuchungen können oft nicht darstellen, wie eingeschränkt das Kind nach der Geburt tatsächlich ist.
Methoden der Pränataldiagnostik
Man unterscheidet zwischen invasiven, also in den Körper der Mutter eingreifenden, und nicht invasiven Verfahren.
Nicht invasive Methode
Ersttrimester-Screening
Der Test besteht aus einer Blutuntersuchung und einer Ultraschallaufnahme zwischen der 11. und 14. Schwangerschaftswoche. Per Ultraschall wird die Dicke der Nackenfalte des Fötus gemessen (Nackentransparenz-Test).
Aus dem Ergebnis wird zusammen mit den Blutwerten, dem Alter der Mutter sowie der Schwangerschaftswoche ein Risikowert errechnet, der die statistische Wahrscheinlichkeit für bestimmte Chromosomenstörungen oder Fehlbildungen beim Kind angibt.
Ab einem bestimmten Risikowert wird dazu geraten, eine Chorionzotten- oder Fruchtwasseruntersuchung durchführen zu lassen, um den Verdacht zu bestätigen oder auszuräumen.

Es ist wichtig, die möglichen Konsequenzen zu bedenken, bevor man sich für oder gegen die Pränataldiagnostik entscheidet.
Invasive Methoden
Chorionzottenbiopsie
Hierbei wird durch die Bauchdecke hindurch Zellgewebe aus dem entstehenden Mutterkuchen entnommen. Die Untersuchung der Zellen erlaubt zuverlässige Aussagen über eine mögliche Erkrankung oder Behinderung des Ungeborenen, hat aber auch das Risiko einer Fehlgeburt. Es liegt bei 0,5 bis zwei Prozent.
Fruchtwasseruntersuchung (Amniozentese)
Fruchtwasser wird aus der Fruchtblase der Mutter entnommen und die darin enthaltenen Zellen des Kindes auf Chromosomenabweichungen und vererbbare Erkrankungen untersucht. Auch bei der Fruchtwasseruntersuchung besteht das Risiko einer Fehlgeburt von 0,5 bis zwei Prozent.
Nabelschnurpunktion
Blut des Kindes wird aus der Nabelschnur entnommen und auf Blutarmut oder Infektionen hin untersucht. Diese sind im Mutterleib behandelbar, andere Befunde hingegen nicht. Das Risiko einer Fehlgeburt liegt bei einem bis drei Prozent und ist damit relativ hoch.
Die Krankenkasse zahlt meist nicht
Wenn kein Verdacht auf eine Auffälligkeit in der Entwicklung des Kindes besteht, müssen diese Untersuchungen selbst bezahlt werden.
Ergeben sich im Laufe dieser Untersuchungen oder auch bei den regulären Vorsorgeuntersuchungen Hinweise auf eine Beeinträchtigung der kindlichen Entwicklung, werden die Kosten weiterer Untersuchungen von den Kassen übernommen.
Frauen über 35 haben Anspruch auf eine Fruchtwasseruntersuchung.
Und was kommt nach der Diagnostik? Erleichterung und Beruhigung, oder aber die große Belastung, vor schweren Entscheidungen zu stehen. Auch kann es sein, dass die Ergebnisse nicht eindeutig ausfallen oder die Untersuchung eine Fehlgeburt auslöst.
Wichtig ist, sich dieser Konflikte bewusst zu sein und die Konsequenzen schon vor Beginn der Pränataldiagnostik miteinander und mit dem Frauenarzt zu besprechen.